Fr. Mößinger (1936)
 Hessen
Hessen  Lkr. Bergstraße
Lkr. Bergstraße

Fr. Mößinger (1936) |
PLZ:
69434GPS:
N 49° 26,724', O 8° 54,476'Standort:
Abseits der L 3105 Richtung Eberbach am Ackerrand neben dem Neckar.Größe / Material:
180:107:23 / SandsteinGeschichte:
Dieses Steinkreuz ist eines der interessantesten der Bestandsaufnahme. Der Standort bezeichnet die Stelle, an der sich der schon vor dem Dreißigjährigen Krieg wüst gewordene Hof Weidenau befand, zu dem das Kreuz offenbar aber keine Verbindung hat.Sage:
An dieser Stelle wurde jemand von seinem Bruder ermordet. Von Reue gepackt, ließ der Täter das Kreuz errichten. Eine typische Steinkreuz-Wandersage. Diese Sage wird später ausgeschmückt und schließlich zur Novelle und zum Roman, die in die Literatur Eingang fanden (A. Schmitthenner: Das deutsche Herz). Kern der späteren Sage: Hier habe ein Ritter von Hirschhorn einen Gefährten erschlagen und zur Sühne das Kreuz errichtet. Sogar den Namen des Erschlagenen erfährt man: einen Ritter von Vellberg.Quellen und Literatur:


der Waldbrudershütte vor der Beschädigung. Aufnahme nach einer Abformung des Landesamtes für Denkmalpflege Hessen im Jahre 1974. |
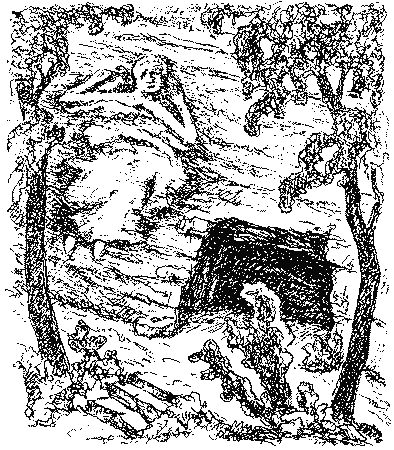
Friedrich Löffler für Matthes (1952) |
GPS:
N 49° 27,472', O 8° 52,116'Standort:
A5 Abfahrt Heidelberg, von dort nach Osten auf der B 37 Richtung Eberbach / Hirschhorn. In der Ortsmitte Hirschhorn nach Nordwesten auf die L 3105 Richtung Wald-Michelbach / Langenthal. Nach etwa 2km geht ein Feldweg nach links über den Ulfenbach. Hinter der Brücke führt der Weg zunächst rechts und dann nach etwa 100 m links in eine tief eingeschnittene Schlucht, an deren Nordwand, erreichbar über einen Pfad, die "Waldbrudershütte" liegt.Größe / Material:
Geschichte:
Eine der von Göldner (1989) beschriebenen Abformungen der Figur befindet sich heute im Langbeinmuseum in Hirschhorn. Im Rathaus von Hirschhorn und im Volkskundemuseum Heppenheim sind diese Abformungen nicht mehr zu sehen. (Geyer 11/2018)Sage:
Der Sage nach, soll in der Waldbruderhütte ein Einsiedler gelebt haben, der dem Geschlecht derer von Hirschhorn entstammte, jedoch als Findelkind ausgesetzt wurde.Quellen und Literatur:
 |
Das Felsbild im Ulfenbachtal |
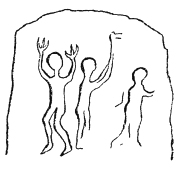 |
 |
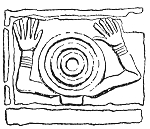 |
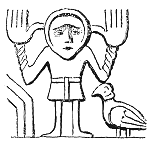 |
 |
 |
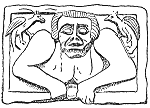 |
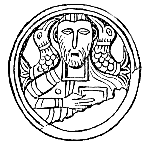 |
 |
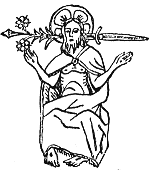 |
 |
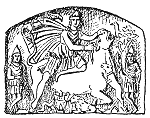 |
 |
 |
Die sagenhafte Überlieferung, die an dieser Stelle haftet, ist leider nicht sehr alt, gibt aber dem tiefer Blickenden doch
mancherlei Hinweise. Im Jahre 1851 erschien in den "Blättern für Vergangenheit und Gegenwart", dem Beiblatt zur Hanauer Zeitung, eine Novelle von J. Feldkircher:
Die letzten Ritter von Hirschhorn und Handschuhsheim. Sie wurde später von Schmitthenner für seinen Roman "Das deutsche Herz" benutzt, der für unsere Betrachtung
nicht herangezogen zu werden braucht. Bei Feldkircher heißt es: "Leonhard, der sich nicht weit von seinem Geburtsstädtchen und der Burg entfernen wollte, weil er
immer noch hoffte, die Reste seiner Mutter zu finden, zog hinter das sogenannte Drachenbrünnlein (aus welchem, nebenbei bemerkt, alle Knaben in Hirschhorn
stammen) hinaus in das Langental. Eine halbe Stunde von Hirschhorn entfernt befindet sich noch jetzt auf einer steilen Anhöhe ein teilweis unterhöhlter Felsen. Hier
baute sich Leonhard eine kleine Hütte, die von einem Lindenbaume beschattet, mit Stroh gedeckt war, und arbeitete in derselben wie früher in Hirschhorn." Der Felsen,
so fährt später Langheinz in einer Besprechung der Novelle von Feldkircher fort, mit einigen schwachen .Spuren von Leonhards ehemaligem Wohnorte ist noch heute
zu sehen und wird vom Volke genannt die Einsiedlerhöhle oder das Waldbrudershäusel. An dem Gestein, noch wahrnehmbar ist in kunstlosen Umrissen Leonhards Bild
eingehauen mit einem Vogel, denn er pflegte in der Einsamkeit gerne Vögel zu zähmen.
Soweit die Sage, der nur noch hinzuzufügen wäre, daß auch auf dem Meßtischblatt Hirschhorn die Stelle mit dem Namen "Waldbrudershütte"
bezeichnet ist. Es ist nun offenkundig, daß diese Sage nur als weitgehend verderbt bezeichnet werden kann. Unmotiviert ist die Verbindung mit dem Brünnlein, aus dem
die Hirschhörner Knäblein kommen; rein äußerlich erklärt ist der Vogel, der dem Manne auf der Schulter sitzt. Uns aber führt der Name Leonhard weiter. Es kann kein
Zweifel sein daß wir ihn nicht als Namen eines Hirschhörner Ritters letztlich zu verstehen haben, sondern daß hinter ihm sich der Heilige Leonhard verbirgt, der im
Odenwald in aller Zeit besondere Verehrung genoß.
Über die tieferen Gründe dieser Verehrung - ob als Befreier der Gefangenen, als Schützer des Viehs, als Pferdeheiliger oder als Patron der
Hammerleute in den Eisenwerken - läßt sich nichts Genaues sagen. Beliebt war auf jeden Fall früher der Name Leonhard als Personenname. Es gibt bei uns einen
Leonhardskopf bei Güttersbach und bei der Lichtenklinger Kapelle, einen
Leonhardsgrund bei Obersensbach, einen Leonhardsberg mit einer Leonhardskapelle bei Hüttental,
eine alte Eisenschmelze und der bekannte Lintbrunnen in der Nähe. Die Leonhardkapelle bei dem Leonhardshof zwischen Beerfelden und Falkengesäß war weit
berühmt wegen des Heilwassers, und hier haben wir also das gleiche Nebeneinander von Leonhard und Quellkult wie bei unserem Hirschhorner Felsbild. Es darf nun
nicht geschlossen werden, als sei die Hirschhörner Gestalt ein mittelalterliches Bild des Heiligen Leonhard. Weder die erhobenen Hände noch der Vogel auf der
Schulter ließen sich damit unmittelbar vereinen. Wohl aber hat die Sage durch diesen Namen Leonhard, den sie sogar mit dem eines Einsiedlers und Waldbruders
verbindet, den religiösen und kultischen Charakter der Figur im Gedächtnis der Leute erhalten. Die erhobenen Hände erfahren so ihre richtige Deutung. Daß dabei in
dem Vogel und dem Kinderbrunnen ein ähnlicher religiöser und kultischer Sinn liegt, wird freilich von der Sage gerade nur geahnt. Auf jeden Fall ist die einzigartige
Vereinigung der drei Motive, der erhobenen Hände, des Vogels auf der Schulter und des Kinderbrunnens, nicht nur in den wirklichen Denkmälern, sondern auch in der
Sage vorhanden. Sie nun gesondert zu betrachten, wird uns zu weitgehender Klärung führen.
Daß es sich bei dieser ungemein feierlichen und uns allen innerlich verständlichen und vertrauten Gebärde um etwas
Uraltes handelt, läßt sich leicht erweisen. Schon die nordischen Felsritzungen der Bronzezeit zeigen Gestalten, die beide Hände heben. Das einzige deutsche
vergleichbare Beispiel, der Wandstein einer Grabkammer von Anderlingen, Kreis Bremervörde, der älteren Bronzezeit
zugeschrieben, gibt drei Gestalten, von denen die eine dreifingrige Hände emporreckt. Ob es sich hier um Götter handelt, ist nicht ganz sicher, wohl aber, daß etwas
Religiöses oder Kultisches gemeint ist. Ähnlich sind eine ganze Anzahl von frühfränkischen Zierscheiben, die einen Reiter mit hoch erhobenen Armen darstellen. Sie
hatten ohne Zweifel eine über den reinen Schmuck hinausgehende amulettartige Bedeutung. Der Reiter auf der Scheibe aus Mörstadt
in Rheinhessen hat bezeichnenderweise drei Finger durch Ritzung angedeutet, doch soll auf diesen Zug nicht weiter eingegangen werden. Ob sich hinter diesem Reiter,
der auch auf Schnallen und Scheiben aus getriebenem Goldblech, manchmal mit einer Lanze, vorkommt, der Gott Wodan verbirgt, ist nicht sicher, aber sehr
wahrscheinlich. Im übrigen kennen wir ein Figürchen eines knieenden Germanen, der beide Hände zum Gebet hebt. Auch der bekannte Diedrichstein aus Bingen, der
dem 9. oder 10. Jahrhundert angehört, gibt eine Gestalt wieder mit eigentümlich gewinkelt erhobenen Armen. Rätselvoll ist ein Steinrelief, das an der Tübinger Stadtkirche
eingemauert ist. Daß es nicht mit dem Kirchenbau entstanden ist, sondern aus früherer Zeit stammt, ist wohl sicher. Was aber die drei Kreise an der Stelle des Kopfes
bedeuten, ist wohl nicht befriedigend erklärt. Uns interessieren hier die hochgestreckten Hände, die in Verbindung mit der geheimnisvollen Gestaltung religiöse Deutung
nahelegen. Bei dem Quedlinburger Kapitell könnte man eher an eine Laune des Bildhauers glauben, doch gibt der auffällige Vogel immerhin zu denken.
Es ist nun außerordentlich wichtig, daß diese eindrucksvolle Handhaltung auch sehr häufig auf christlichen Denkmälern zu sehen ist. Auch
der Christ betete in der alten Kirche mit offen zu Gott erhobenen Händen. Diese Haltung hat sich sogar bis heute beim "Baumbeten" bewahrt, wenn der Bauer am
Gründonnerstag auf seinen Anger hinausgeht, unter einem Baum niederkniet und mit ausgebreiteten Armen sein Gebet verrichtet. Eine Katakombenmalerei
des 4. Jahrhunderts stellt Maria mit dem Jesusknaben dar, erhobene Arme und Hände kennzeichnen sie als Betende. In ähnlicher Stellung schon wir in einem Mosaik
in Kavenna aus dem 6. Jahrhundert den hl. Apollinaris unter seinen Schafen. Hier mag die Gebärde weniger ein Beten, sondern eher ein Segnen, vielleicht sogar nach
einer sehr einleuchtenden Annahme von Güntert ein Walten oder Herrschen bedeuten. Er hat diese Haltung bis weit in die indogermanische Frühzeit zurückgeführt, sie
kommt aber auch das ganze Mittelalter hindurch bei den Darstellungen des Weltgerichts vor. Mit weit ausgebreiteten oder geknickt erhobenen Armen thront Christus
als Weltenrichter über den Seligen und Verdammten. Ich nenne nur Werke dieser Art an den Kathedralen zu Vezelay und
Reims, in Bamberg und Rottweil. Selbst späte Darstellungen des Weltgerichts auf gußeisernen Ofenplatten weichen von dieser Formun des waltenden, richtenden
Heilandes nicht ab, und der steirische Bauern0 kalender, der sehr alte Holzschnitte zu den Abbildungen seiner Monats-und Tagebilder benutzt, bringt zum 1. Advent
das Christuskind in derselben Haltung, in deutlicher Erinnerung an das Weltgericht. Erwähnenswert, wenn auch letztlich nicht hierher gehörig, sind Gestalten mit hoch
erhobenen Armen, die als Füllung des Fachwerks vereinzelt zu finden sind. In Bauerbach, Kreis Marburg, in Wolfach und Jechtingen in Baden sind es Männer, in
Niederkleen bei Gießen eine weibliche Gestalt, die als Balkenträger in dieser Form mit den. hier aus äußerlichen, nicht religiösen Gründen erhobenen Armen ausgesägt
und leicht geschnitzt sind.
Rückschauend ist nun zu sagen, daß das Motiv der erhobenen Hände unzweideutig in die Tiefe religiöser Haltung verweist, daß es sich aber
nicht auf eine bestimmte Religion und noch weniger auf eine bestimmte Zeit festlegen läßt. Es ist so weit verbreitet, läuft auch auf so vielen verschlungenen Wegen
durch die Räume und durch die Zeiten, daß für unser Hirschhörner Felsbild vorläufig dadurch keine Klarheit zu gewinnen ist. Und dies gilt erstaunlicherweise auch für
das folgende Motiv.
Der heutige Beschauer des einsamen Bildes im Ulfenbachtal denkt wohl als erstes an Wodan und seine Raben, die ihm
auf die Schulter fliegen, um ihm ins Ohr zu flüstern, was sie in der Welt sahen und hörten. Das Bild eines Reiters mit zwei fließenden Raben auf einem germanischen
Helm zu Wendel ist denn wohl auch zu recht als eine Darstellung Wodans angesehen worden. Aber auch dem griechischen Apollo war der Wolf und der Rabe heilig.
Letzterer meldete ihm die Untreue der Koronis. Und in der Mithrasreligion spielt der Rabe eine besondere Rolle. Als Bote des Sonnengottes überbringt er dem Mithras
den Befehl zur Tötung des Stieres und wird deshalb häufig auf den .Kultbildern dargestellt, wie er dem Gölte auf dem Mantel sitzt, deutlich z.B. auf dem in
Heddernheim gefundenen Mithrasbild. Daneben aber gibt es germanische Darstellungen auf den Goldbrakteaten der
Völkerwanderungszeit, die hierher gehören. Es sind münzenähnliche Goldscheiben, denen man magische Kräfte zuschrieb, wohl wegen der Runeninschriften und der
Darstellungen von göttlichen Wesen, die sie trugen. Besonders schön und unserem Felsbild am nächsten verwandt ist der Brakteat vom Skrydstrup.
Man sieht da einen Mann zwischen einem Hirsch und einem Wolf. Er hebt beide Hände. Ein Vogel scheint ihm ins Ohr zu flüstern. Eigenartig ist der zweite Vogel, der
als eine Zier seines Helmes zu denken ist, vielleicht aber aus einem Mißverständnis des zweiten Wodansraben zu erklären ist. Daß heidnisch-germanische
Anschauungen in das Christentum hineinwirken, zeigen die Schilderungen von Christi Taufe. Während die Evangelien von einem Herabkommen der Taube sprechen,
sagt Otfried, daß sie sich auf ihn niederließ, und im Heliand setzt sie sich auf unseres Herrn Achsel. Eigenartiger und wohl noch mehr vom Germanischen her
bestimmt ist das Mittelstück eines frühchristlichen Grabsteins aus Gondorf an der Mosel. Auf den Schultern eines Priesters,
ihre Schnäbel nach seinen Ohren reckend, sitzen zwei Vögel, ohne Zweifel hier nicht ohne besondere Bedeutung angebracht. Wenn man sie als Bringer des göttlichen
Geistes in der Art des Heiligen Geistes als Taube auffaßt, so bleibt doch ihre Zweiheit sehr auffällig und am ehesten aus Wodanserinnerungen erklärlich. Spätere
Darstellungen von göttlichen Inspirationen bei heiligen Männern geben denn auch nur einen Vogel, so etwa die Taube am
Ohre des hl. Gregor in einem Sakramentar Kaiser Heinrichs II. und Bilder des hl. Augustin und des hl. Thomas von Aquino.
Ein hübsches Kindermärchen aber hat zwei Vögel festgehalten. Es handelt von einem Grafensohn, der drei Sprachen, die
der Hunde, der Vögel und der Frösche erlernt. Er wird schließlich Papst in Rom, als sich wunderbarerweise zwei schneeweiße Tauben auf seine Schultern setzen. "Die
sagten ihm alles ins Ohr". Hier ist die enge Verwandtschaft mit dem Wodansmythos noch sehr deutlich.
Bezeichnenderweise kommt aber auch die abschätzige Meinung dieser. als unchristlich empfundenen Vögel in manchen Denkmälern zum
Ausdruck. Der Unhold von Mürlenbach mit den beiden Vögeln ist dafür ein gutes Beispiel. Ein ähnliches Bild muß auch in
Niederkirchen in der Pfalz und in Zürich vorhanden sein. Und schon ein gallo-römisches Relief in Compiègne zeigt eine Gestalt,
der zwei Vögel auf den Schultern sitzen. Am eindeutigsten aber ist ein Bild, das sich in dem bekannten Buch der Herrad von Landsberg
findet. Hier werden unter den sieben freien Künsten auch vier heidnische Poeten gezeichnet, die von unreinen Geistern inspiriert werden. Es sind schwarze hochbeinige,
dürrhälsige Vögel, die ihnen auf der Schulter sitzen und ihnen ihre Weisheit ins Ohr sagen. Sicherlich will der Künstler damit Raben kennzeichnen, die ja im ganzen
Mittelalter als Teufelstiere galten. Wieso aber gerade die Raben zu dieser Teufelsverbindung kamen, zeigt deutlich eine Stelle in dem Puppenspiel vom Dr. Faust. Der
Vogel, der den Pakt vom Teufel zu Faust bringt, ist ein Rabe und wird als Vogel Merkurs bezeichnet. Merkur ist aber die römische Umdeutung des germanischen
Wodan. Die Verteufelung dieses Gottes drückt sich also auch in der Verteufelung seines Vogels aus.
Im übrigen kennen wir Rat gebende Vögel in der Dichtung recht häufig. Man braucht nur an Siegfried zu erinnern. Seltener sind schlechte,
heimtückische, also teuflische Ratschläge, wie in Meister Hagens kölnischer Reimchronik von 1270 zu lesen ist. Als der Bischof Engelbrecht Anschläge wider die
Stadt plante, hörte er ein Vöglein ein neues Lied singen. "Herr Bischof, wollt ihr Herr sein von Köln der Stadt, über arm und reich all euer Leben lang, darzu will ich
euch Rat geben". "Ja, sing an, Vögelchen! Ich will dir folgen." Und nun rät ihm der Vogel, daß er sich heimlich bewaffnen und einen treulosen Überfall auf die Stadt
machen soll.
Aehnlich, aber viel freundlicher sind die vielen Geschichten, wo Vögel eine Botenrolle übernehmen. Bei Liebenden ist es oft die Nachtigall,
es kommt aber auch der mit Gold gezierte Falke, wenn auch ein wenig anders gemeint, in alten Liedern vor. Am schönsten und tiefsten aber ist der Mythos vom
König Oswald und seinem Raben, dessen Gefieder mit Gold bewunden wird. Der Vogel redet mit seinem Herrn, setzt sich
ihm auf Arm oder Achsel und wird als Bote und Werber zu der ersehnten Jungfrau gesandt. In bildlichen Darstellungen des heiligen Oswald, die im Alpengebiet häufiger
sind, trägt er regelmäßig einen Vogel auf der Schulter. Von der bösen und teuflischen Natur des Raben, die ihm später beigelegt wird, ist hier noch nichts zu spüren.
Eigenartig ist eine in Prenzlau gefundene Münze, die Jung abbildet. Man sieht einen schnurrbärtigen Mann, der seine Arme um die Hälse
zweier Vögel schlingt. Sie sitzen ihm zur Seite, strecken aber ihre Schnäbel an seine Ohren. In ganz ähnlicher Weise faßt an einem Kapitell in der Marienkirche zu
Gelnhausen ein Mann die Hälse zweier Vögel, deren Schnäbel allerdings mehr sein Kinn berühren. Auch in Andernach
gibt es an der Pfarrkirche einen Kopf mit zwei Vögeln an den Ohren. Leicht ließe sich die Zahl derartiger Denkmäler noch vermehren; immerhin schien es nötig, so viele
hier anzuführen, um die weite Verbreitung des Motivs klar werden zu lassen. Dabei fällt jedoch sofort die Einzigartigkeit des Hirschhorner Felsbildes wieder auf. Keines
der Bilder kennt die Vereinigung der erhobenen Hände und des Vogels auf der Schulter. Einzig der schon genannte Brakteat von Skrydstrup ist ähnlich. Allerdings hat
man die Handhaltung des Mannes hier nicht als Segensgebärde gedeutet, sondern vermutet, es solle der rufende wilde Jäger charakterisiert werden. Da auf verwandten
Brakteaten die eine Hand tatsächlich an den Mund gehalten wird, wahrend die andere herabhängt, ist diese Deutung wahrscheinlich; unser Hirschhorner Relief steht
aber dann erst recht allein. Verwandt erscheint nun auch ein Kreuzigungsbild eines irischen Epistolars in Würzburg, dessen Oberteil wir hier abbilden. Auf dem
Querbalken des Heilandskreuzes sitzen zwei Vögel, fast so als redeten sie Christus in die Ohren. Ob hier an Boten Gottes zu denken ist, die hier in urtümlicherer
Weise die späteren Engel vertreten, oder ob dunkle Erinnerungen an Wodans Vögel lebendig sind, kann nicht entschieden werden. Auf jeden Fall steht auch bei dem
Vergleich mit diesem Kreuzigungsbild unser Hirschhorner Felsbild allein.
Zum Schluß sei noch eine Sage angeführt, die von der Burg Stolzeneck bei Eberbach, also aus
nächster Nähe von Hirschhorn, erzählt wird. Das Burgfräulem wurde von einem ungeliebten Freier bedrängt und schließlich von ihm in das Burgverlies geworfen. Da
kam ihr zahmer Rabe geflogen und brachte ihr Beeren und andere Früchte. Später befreite der Bruder die Gefangene und kämpfte mit dem Freier, .wobei eine Schar
Raben Hilfe leistete. Sie hackten dem Besiegten zuletzt die Augen aus. Hier spielt also der Rabe, ganz nach alter Art, die Rolle eines guten Helfers, Überschauen wir
nun noch einmal alle hier beigebrachten Beispiele, so wird klar, daß sich in der Vorstellung von dem Vogel auf der Schulter christliche Züge mit germanischen,
gallo-römischen und antiken weitgehend mischen; immerhin scheinen die christlichen sehr stark von germanischen beeinflußt zu sein, vielleicht sogar ganz auf sie
zurückgehen, so daß zur Deutung unseres Bildes der Gedanke an Wodan (oder einen keltischen Gott?) naheliegt.
Wenn die Sage von der Quelle unterhalb des Felsbildes berichtet, daß aus ihr die Knäblein von Hirschhorn kommen, so ist
dies nicht besonders bemerkenswert. Die Zahl der Quellen, die in Hessen und weit darüber hinaus als Kinderbrunnen gelten, aus denen also nach dem Volksglauben
durch den Storch oder ein anderes Wesen die Kleinen geholt werden, ist ungeheuer groß. Neben ihnen treten Felsen oder Bäume, aus denen die Neugeborenen
kommen, weit zurück. Viel eigenartiger aber ist die Meinung, daß das Wasser der Quelle im Ulfenbachtal Segens- und Fruchtbarkeitskräfte in sich berge, die man durch
seinen Genuß Gewinnen kann. Hier ist urältester Quellkult bis in unsere Tage lebendig geblieben. Es ist nun erstaunlich, daß gerade der Odenwald derartige
Anschauungen, wenn auch oft nur resthaft, an mancherlei Stellen erhalten hat. Da ist zuerst die schon genannte Leonhardskapelle aufzuführen, deren Wasser in aller
Zeit große Wallfahrten entstehen ließ. Nicht anders war es mit Schöllenbach, wo das kühle Naß unter der Kirche entspringt,
heute noch in ebenso mächtigem Strom wie im Mittelalter. In Hesselbach heilte das Wasser der Ottilienquelle Schmerzen
des Kopfes und der Augen. Derselben Heiligen ist auch die stark fließende Quelle in Rüdenau geweiht; dort wurde ein
römisches Nymphenrelief gefunden, das wohl seit der Erbauung der Kirche in ihre Außenwand eingemauert ist. Man kann vermuten, daß schon die Römer der Quelle
ihre Verehrung erwiesen; Steinbild und Heilwasser sind hier vereint wie bei dem Felsbild bei Hirschhorn. Auch in Neunkirchen galt
die Quelle bei der Kirche früher als heilkräftig, nicht minder eine Quelle in einer Wiese bei Walderlenbach, zu der man sogar
die Pferde zum "Brauchen" trieb. Man denkt dabei, ohne weiteres an den Vieh- und Pferdeheiligen Leonhard. Am wichtigsten ist in diesem Zusammenhang natürlich
Amorsbrunn, wo in der Kapelle, die sich wunderbar an den Bergabhang schmiegt, die Erinnerungen an den Kindersegen
noch zu sehen sind. Daß hier auch ein Heiligenbild vorhanden ist, das des hl. Amor, erscheint der Hirschhorner Sache irgendwie verwandt. Im Bayrischen Wald gibt es
gar eine Wallfahrtskirche, wo der hl. Oswald mit einem Raben auf der Schulter bei einer wundertätigen Quelle dargestellt ist. Wie weit dieses Nebeneinander zurückgeht,
zeigt eine Stelle aus dem Leben des hl. Columban, der 615 gestorben ist. Dort wird aus Frankreich von dem Kult an einer heißen Quelle erzählt, an der Steinbilder der
heidnischen Burgunden stehen. Im übrigen ist nicht nur germanischer, sondern auch römischer Quellkult bei uns durch Münzfunde besonders gut belegt. Ich nenne nur
den Sauerbrunnen von Schwalheim, das Sironabad bei Nierstein, Brunnen bei Andernach, Bonn und in der Eifel. Hie und da findet sich auch ein Steinbild, so besonders
altertümlich im Quellhaus zu Niedernau bei Rottenburg am Neckar der eingemauerte Apollo Grannus.
Ueber den inneren Zusammenhang zwischen Wasser und Felsen gibt uns eine Nachricht aus dem Elsaß Auskunft. "Frauen, welche wünschen,
Mütter zu werden, tragen Wasser aus der Mineralquelle von Niederbronn nachts auf die umliegenden Berge mit den zahlreichen Schalensteinen, begießen dort die
sogenannten Altäre, eben die Schalensteine damit und legen ein Opfer in die Schalen".
(Rütimeyer 1924.) So ähnlich mag man sich auch den Vorgang im Ulfenbachtal vorstellen, wenn auch der Elsässer Brauch weitaus urtümlicher ohne ein eigentliches
Kultbild vor sich geht. Daß Quelle und Felsen nicht dicht beieinander zu liegen brauchen, ist bemerkenswert. Man konnte also wohl auch vom Drachenbrünnlein mit
seinem Wassergefäß zum Felsbild hinaufsteigen.
Das Nebeneinander von Quelle und Felsbildern ist nun noch besonders gut zu sehen an drei Stellen in der Nähe von Lemberg in Lothringen.
Bei der Bildmühle ist aus gallo-römischer Zeit eine sitzende Frau mit einem Füllhorn in einer Nische eingemeißelt. Die Quelle
in unmittelbarer Nähe deutet wohl auf eine Quellgöttin. Auch im Dreibirretal, das seinen Namen nach drei Brunnen hat befindet
sich ein Felsbild, in einer Doppelnische zwei stehende Gestalten, hinter denen man ein keltisches Götterpaar vermutet. Die Höhe der Figuren von 1,40 Meter entspricht
etwa der des Hirschhorner Bildes. Noch eindeutiger ist die Verbindung einer Quelle mit einem großen Felsbild beim sog. Bumboosebrunnen.
Die Gestalten freilich scheinen dem eigentlichen Quellkult wie überhaupt religiösem Urgrund fremder. Man erkennt noch Hirsche, Hunde, ein Wildschwein, Pferdeköpfe
und zwei Menschen mit Speer und Bogen ais Brustbilder. In einer kleinen Nische sieht man, dem Wasserkult entsprechend, eine Nymphe mit Amor. Mancherlei Sagen,
zum Teil hervorgelockt durch den trümmerhaften Zustand der Bilder, zum Teil auch durch die geheimnisvolle Waldeinsamkeit, leben noch bis heute in der Erinnerung der
Bewohner. Zur Klärung der Entstehung tragen sie freilich kaum bei.
Was nun die Bedeutung des Quellkultes für das Hirschhorner Bild angelangt, so ist auch hier eine eindeutige Entscheidung nicht leicht
möglich. Soviel ist jedoch klar, daß weit und tief vor dem Christlichen an dieser Stelle Germanisches oder gar keltische und römische Bräuche wirksam waren und sich
über alle äußeren Wandlungen hinweg unverändert fortgeerbt und erhalten haben. Und weiterhin ist klar, daß ihr Urgrund letztlich im Religiösen, in der Verehrung
göttlicher Kraft des Wassers liegen muß.
Nachdem die Betrachtung der Quellheiligtümer uns zum Schluß zu einigen Felsbildern führte, muß nun noch diese
Eigenart des Hirschhorner Reliefs besprochen werden. Daß es aus einem natürlich anstehenden Felsen herausgehauen ist, der selbst dabei seine Naturform fast ganz
behielt, unterscheidet es ja von allen Altären, Weihinschriften und Standbildern der Römer, nicht minder aber auch von Heiligenstatuen, Gemälden und freistehenden
Reliefs des Mittelalters. Hier muß sich eine urtümlichere, naturhaftere, Frömmigkeit ausdrücken. Verwandt sind dabei nicht nur die schon genannten lothringischen
Felsbilder, deren Ursprung am ehesten in keltischer Naturreligion zu suchen ist, sondern auch die zahllosen Felsritzungen der Bronzezeit in Südschweden und die der
südlichen Alpentäler.
Freilich sind diese sehr viel primitiver, nicht nur wegen ihrer einfachen Ritztechnik, die keinerlei plastische Wirkung wie spätere Felsreliefs
erstrebt, sondern auch wegen ihrer schematischen und stark vereinfachenden Zeichnung. Immerhin deuten sie uns das hohe Alter der Sitte an, deren Wetterführung
wir sowohl im Keltischen wie im Germanischen verfolgen können. Daß die römische Steinmetzkunst zwar eingewirkt hat, ist leicht sichtbar. Man spürt dies nicht nur
bei dem schon genannten Relief am Bumboosebrunnen, sondern noch deutlicher an einem reichen Felsrelief bei Landstuhl
und einem kleineren bei Eppenbrunn, wo drei Gestalten nebeneinander stehen. Einheimisch und wohl keltisch aber muß
der Untergrund all dieser Werke sein. Felsbilder bietet auch der bekannte Brunholdisstuhl bei Bad-Dürkheim. Neben
zeichenhaften Darstellungen findet man hier auch Menschen und Pferde in flachem Relief. Ob hier germanische Steinmetzen in römischem Auftrag arbeiteten, ist
allerdings nicht ganz sicher. Das Christentum scheint eigentliche Felsbilder nicht sehr geliebt zu haben. Nur an den Externsteinen
finden wir diese Darstellungsart, hier freilich sehr monumental und eindrucksvoll. Wenn aber die Heiligkeit der ganzen Felsgruppe auf heidnische Zeit zurückgeht,
dann könnte sich auch in diesem mächtigen Relief germanischer Brauch in christlichem Gewande erhalten haben. Einfache Felsbilder muß es auch in größerer
Anzahl am Brocken im Harz gegeben haben, wie uns alte Walenbücher, die Aufzeichnungen der Goldsucher aus
dem 15. und 16. Jahrhundert, melden. Nur eines von ihnen ist bis heute erhalten, der sog. "Mönch" am Brocken, ein sehr flaches Reliefbild eines Menschen, das
stilistisch auf eine bestimmte Zeit nicht festzulegen ist.
Für unser Hirschhörner Felsbild ergibt sich aus all diesen Vergleichen, daß weder römischer noch christlicher Ursprung angenommen
werden darf, daß also die Frage nur noch lauten kann: Keltisch oder germanisch? Daß auch hier die Entscheidung nicht leicht, auch nicht eindeutig sein kann, sollen
die folgenden Ausführungen erweisen.
Zur Beantwortung dieser Frage wäre es wichtig, das Felsbild zeitlich genau festzulegen. Daß das ganze Gebiet in den
Jahrhunderten vor Christi Geburt von Kelten besiedelt war, ist sicher. Der Name von Ladenburg geht auf eine keltische Benennung zurück, zahllose Fluß- und
Bachnamen ebenso. Noch in römischer Zeit werden dem gallischen Merkur (Visucius bezw. Arvernorix) auf dem Heiligenberg bei Heidelberg und auf dem Greinberg
bei Miltenberg Weihesteine gesetzt. Aber gleichzeitig an den gleichen Stellen treffen wir auf Steine für den Mercurius Cimbrianus, unzweifelhaft den germanischen
Wodan, der auf diesen Bergen damals verehrt wurde. Daneben zeichnet sich durch die Funde im ganzen unteren Neckargebiet eine ziemlich dichte Besiedlung durch
die germanischen Sueben ab, die schon lange vor der Römerherrschaft hier wohl recht friedlich neben und unter den keltischen Helvetiern wohnten. Wenn nun unser
Felsbild in diesen ersten Jahrhunderten vor Christi Geburt entstanden ist, dann könnte es wohl keltisch wie germanisch sein. Raben als prophetische Vögel und Quellkult
finden sich ähnlich bei beiden Völkern. Vom Inhaltlichen her ist also eine genaue Scheidung unmöglich. Wohl aber scheint stilistisch ein Unterschied zu sein. Es gibt
zwei Funde, die sich durch ihre Eigenart als keltisch erweisen und die hierher gehören. Das Fischblasenornament der Steinsäule von St. Goar und eines bei Heidelberg
gefundenen Kopfes in Verbindung mit anderem Spiralwerk an der Säule ist untrügliches Kennzeichen dieser keltischen Kunst. Die dargestellten Köpfe nun haben eine
eigentümliche Birnform, die auch sonst bei keltischen Kleinkunstwerken vorkommt. Der Kopf von Hirschhorn aber ist ganz anders gestaltet; er ist rundlich, in der unteren
Partie breit, fast plump, wie auch das ganze Werk primitiver, urtümlicher, steifer erscheint als etwa die völlig mit elegantem Zierart überdeckte Steinsäule von St. Goar.
Es liegt daher nahe, nachdem die Hörner am Kopf der Gestalt sich als sehr unsicher darstellen, an ein Werk der Sueben im Neckartal zu denken. Man kann annehmen,
daß sie von ihren keltischen Mitbewohnern vergleichbare Götterdarstellungen kennen lernten; keltische und germanische Götter haben ja auch noch später recht enge
Beziehungen gehabt, wie wir am deutlichsten an den Matronen sehen. So mögen also diese Sueben zur figürlichen Darstellung angeregt worden sein und sie auf ihre
plumpe, ungeübte Weise ausgeführt haben. Wenn wir auch nicht mit Jung vom „Himmelsgott der Neckarsueben" reden wollen, weil für diese Frühzeit sich ein derartiger
Gott nicht beweisen läßt, so liegt doch eine Deutung in einer solchen Richtung nahe.
Es hat nämlich im Jahre 1938 R. v. Kienle in einem besonnenen und klaren Aufsatz
über das Auftreten keltischer und germanischer Gottheiten zwischen Oberrhein und Limes im Archiv für Religionsgeschichte Band 35 wahrscheinlich gemacht, daß sich
die zahlreichen römischen Weihesteine für Jupiter optimus maximus (IOM) und Juno regina (IR) auf germanische Götter beziehen. Diese Paarheit findet sich in Italien
nicht, ist in allen Provinzen selten, drängt sich aber am Rhein und Main, wenn man von den reinen Soldatenweihungen absieht, auffällig in Gebieten germanischer
Besiedlung, u.a. auch dem der Neckarsueben, zusammen, während keltische Religionsäußerungen der obergermanischen Weihesteine sich in anderen Räumen
besonders stark häufen. Kienle denkt dabei wohl mit Recht an den höchsten Gott der Sueben, der uns später als Ziu überliefert ist und den Tacitus in seiner Germania
"regnator omnium deus" nennt. Hinter Juno verbirgt sich wohl die von Tacitus als Erdmutter bezeichnete Nerthus. Wie sehr die oben als Gebärde des Herrschens und
Walten gedeutete Handhaltung des Hirschhorner Felsbildes zu diesem alles beherrschenden obersten Gott paßt, ist augenscheinlich. Erinnert sei hier auch noch an
den klagenden Ausruf Hildebrands in dem alten Liede: "Wehe nun, waltender Gott!", der uns an ein solches Bild des höchsten Gottes mit hoch erhobenen Händen
denken läßt.
Nicht ohne Grund wurde der Rahmen der vergleichbaren Denkmäler sehr weiit gespannt. Es erschien nötig, über eine enge
Betrachtung; hinauszugehen, weil nur so dem Geheimnis des Felsbildes nahe zu kommen war. Sicher ist vor allem der religiöse Charakter des Dargestellten.
Handhaltung und Vogel in Verbindung mit dem Heilglauben erweisen dies klar. Weiterhin scheidet Christliches aber auch Römisches ohne Zweifel aus. Selbst die
primitivsten Werke dieser Kulturen zeigen eine andere Gestaltung. Dies ist auch bei den meisten keltischen Arbeiten der Fall, so daß ein frühes germanisches Werk
wahrscheinlich ist. Daß dies gerade Im Berührungsgebiet mit den Kelten auftaucht, ist nicht verwunderlich. Eine Klärung fordert zum Schluß noch die seltsame,
abseitige und für ein Kultbild fast unverständliche Lage in der Taleinsamkeit. Alles wird sofort klar, wenn man die Quelle als den Ausgangspunkt der Anlage auffaßt.
Sie ist naturgegeben, sie läßt sich nicht verlegen, sie sprudelt seit Urzeiten und war wohl allen Siedlern bekannt und lieb. Wie sie zu der Verehrung kam und wann
das zum ersten Mal geschah, läßt sich nicht mehr feststellen. Vielleicht haben die einwandernden Germanen ihre Heiligkeit von den Kelten übernommen, vielleicht
haben sie diese selber nach allem Glauben erst eingeführt. Auf jeden Fall aber war dieser wohltätige Born die Ursache, daß in seiner Nähe; auf dem Felsen, über ihm,
das eigenartige Bild aus dem Stein gehauen wurde.
Jahrhunderte sind seitdem vergangen. Abgeschliffen und zerstört ist gar viel von dem alten Werk; rätselhaft schaut es den Besucher an; der
geheimnisvolle Zauber aber, der das Ganze umwebt, wird noch lange bleiben und immer wieder zu neuer Betrachtung und Deutung anregen.
(Schriften für Heimatkunde und Heimatpflege im südhessischen Raum, Hrg. im Auftrag der "Südhessischen Post", Heppenheim 1950, S.3-16)Archiv für Hessische Geschichte XIV 1879 S. 28, Behn, Urgeschichte von Starkenburg S. 40, Koch, Vor- und Frühgeschichte von Starkenburg S. 54, Schumacher, Aus Odenwald und Frankenland S. 258, Jung, Germanische Götter und Helden 1931 S. 11, 362, Jung in Festschrift Neeb 1936 S. 36.
Nachtrag: Einem Brief von Prof. Dr. E. Krüger, Marburg, verdanke ich wertvolle Ergänzungen,. vor allem den Hinweis auf eine Felszeichnung im Val Camonica in Norditalien, die einen mit einem langen Kittel bekleideten Hirschgott darstellt, ferner die Nennung des Reliefs des keltischen Waldgottes Dispater-Silvanus, bei dem ein kleines Vögelchen zu sehen ist, hier allerdings auf dem Rücken eines Hirsches sitzend. Im Luxemburgischen Müllertal, östlich des Dorfes Waldbillig gibt es ein Relief eines Gottes, der seine Arme zum Kopfe hebt. Wichtiger noch als diese Erweiterungen des Materials sind die Folgerungen, die Prof. Krüger aus der Lagerung dieser Felsdenkmäler zieht. Sie finden sich im Walde in Gebieten, in denen die ursprünglich gallische Bevölkerung später starke germanische Beimischung erhalten hat. Im übrigen Gallien, ja im ganzen übrigen römischen Reich sind solche Walddenkmäler nur ganz vereinzelt anzutreffen. Man muß annehmen, daß der Sinn dafür, die Nähe der Gottheit. im Walde zu empfinden und sie dort anzubeten, offenbar unter den Galliern nur da entwickelt ist, wo sie die naturnahen Germanen in größerer Zahl in ihre Gemeinschaft aufgenommen hatten. So ist also trotz der Anklänge an keltische Götterdarstellungen bei dem Ulfenbachlalbild an einen Gott der Neckarschwaben am ehesten zu denken.


|
“roten Bild” Mößinger (1932) |
GPS:
N 49° 26,327', O 8° 52,411'Standort:
Im Michelbucher Wald an einem alten Weg, der vom Forsthaus Michelbuch nach Nordwesten verläuft und nach ca. 1km die hessisch - badische Grenze kreuzt, auf der der Bildstock steht.Größe / Material:
280:47:39 / roter SandsteinGeschichte:
Benennung: "Rotes Bild". Der hohe Schaft ist mit breiten Fasen versehen, die unter dem sehr schlanken Häuschen mit 25cm tiefer Bildnische enden. Häuschen und Nische werden durch einen schlanken Kielbogen oben abgeschlossen. Auf dem Kielbogengiebel saß einst ein Kreuz, das abgebrochen, dessen Ansatz aber noch erkennbar ist.Sage:
1. Eine Frau hatte als Folge eines Ehebruchs Vierlinge geboren. Sie verbarg sie in einem Korb, um sie an den Neckar zu tragen und zu ertränken. Am Ort des Bildstocks wurde sie von einem Förster gestellt, welcher die Kinder rettete. Die Frau wurde später am gleichen Ort zu Tode geschleift.Quellen und Literatur:
Im Walde westlich von Hirschhorn, unweit des Forsthauses Michelbuch, steht an einer alten, mit vielen interessanten Grenzsteinen besetzten
Grenze das fast drei Meter hohe "Rote Bild". Auf einem niedrigen, mit Gras überwachsenen Sockel erhebt sich ein hoher, viereckiger, mit Eisenbändern befestigter
Schaft, der oben ein gotisches Bildhäuschen trägt. Ein den First einstmals überragendes Kreuz ist offensichtlich abgeschlagen. Die Nische ist heute leer. Unter ihr ist
die Jahreszahl 1524 eingemeißelt. Auf der rechten, östlichen Wand des Häuschens sieht man ein Wappenschild mit einem Hirschhorn, auf der anderen Seite ein
solches mit dem Wormser Schlüssel und einem Bischofsstab gekreuzt, von einem S an der Kreuzung durchschlungen. Wir befinden uns hier auf der Grenze der
Mainzer Cent Hirschhorn und des Klosters Schönau, so daß wir annehmen müssen, daß unser Bildstock neben seiner Bedeutung für die Frömmigkeit auch den
Sinn eines Grenzmals besaß. Wir denken an den Brombacher Hinkelstein und an das, was wir über den Eulbacher Bildstock von 1513 sagten.
Über den Grund zur Setzung des Bildstocks berichtet eine Sage, die Langheinz nach einer Erzählung aus Grein schon 1875 veröffentlichen konnte.
Vor Jahrhunderten, als man in manchen Punkten weit empfindlicher war als jetzt, hatte sich eine vornehme Frau das Verbrechen des Ehebruches zuschulden
kommen lassen und infolge davon Vierlinge geboren, deren Dasein natürlich dem gestrengen Eheherren absolut verborgen bleiben mußte.
Die gewissenlose Mutter wußte keinen anderen Rat, als die Zeugen ihrer Sünde heimlich zu ermorden und dann in der Tiefe des Neckars zu bergen.
Sie legte die vier Kinder in einen großen Korb, bedeckte sie mit einem Leintuch und eilte durch den dichtesten Wald, um baldmöglichst eine einsame Stelle des
Flusses zu erreichen.
Da, wo jetzt das Rote Bild steht, begegnete ihr ein Forstmann, dem es auffiel, eine so angesehene Frau in diesem wilden Walde zu finden,
noch mehr aber, daß sie, der ja Knechte und Mägde zu Gebot standen, selbst einen schweren Korb auf dem Kopfe trug. Die Frage des Mannes nach dem Inhalte des
Korbes beantwortete jene sichtbar bestürzt dahin, daß es junge Hunde seien, welche in den Neckar sollten geworfen werden. Diese Antwort mußte natürlich noch
mehr Argwohn erregen, und als eben im glücklichen Augenblick eines der Kinder zu schreien begann, war die Verbrecherin entlarvt. Der rechtschaffene Mann rettete
die Kinder und zeigte den Vorfall bei Gericht an. Die Rabenmutter wurde an derselben Stelle zu Tode geschleift; zum Andenken der Rettung der Kinder und als
Warnungszeichen vor böser Tat wurde das Rote Bild errichtet.
Die Sage von der Edelfrau, die ihre Kinder als Hunde ertränken will, ist schon sehr alt und auch weit verbreitet. Sie hängt an vielen adeligen
Geschlechtern, so auch an den Welfen (Welpen = Hunde), und an vielen Familien Hund. Und hier wird uns auch klar, weshalb sich die Sage an das Rote Bild geheftet
hat. Ganz in der Nähe von Neckarhausen finden sich die dürftigen Reste einer alten Burg Hundheim. An dieser Stelle schließt eine andere. Fassung unserer Sage an,
die bei Jakob Bernhard, Kurpfälzer Sagenborn (1933, S.52), so beginnt: Vor langer Zeit wohnte eine stolze, hochmütige Gräfin auf der Burg Hundheim. Während ihr
Gemahl an einer Fahrt in fremden Landen teilnahm, gebar die untreue Ehefrau mehrere Kinder. Sie brachte die zarten Geschöpflein, um ihre Schande zu verbergen, in
einem Korb an den Neckar, wo die eisigen Fluten sie rasch getötet hatten ... Sie war beobachtet worden und wurde von dem Ritter nach seiner Rückkehr zur Strafe
am Roten Bilde zu Tode geschleift. Diese zweite Fassung, die in der Beziehung zum Bildstock undeutlicher ist, insofern sie ihn voraussetzt und nicht sein Entstehen
erklären will, gibt uns deutlich Auskunft, weshalb diese Wandersage gerade im Neckartal sich festgesetzt hat, eben wegen der Namenserklärung dieser Burg Hundheim.
Ein Bildstock ist in keiner der vielen Geschichten von den Hunden vorhanden. Unser Rotes Bild aber ist in die Sage einbezogen worden wohl nicht nur wegen der
räumlichen Nähe zur Burg Hundheim, sondern sicher auch, weil die Odenwälder Menschen das Steindenkmal im stillen Wald angesichts der Ruchlosigkeit und
Unmenschlichkeit der adeligen Mutter in der Sage als eine Mahnung der göttlichen Gerechtigkeit empfanden. Dies drückt sich auch noch in einer zweiten Sage aus,
die von dem Bildstock erzählt wird.
Ein ungetreuer Vormund soll sich vor langer Zeit am Roten Bild erhängt haben, als seine Unterschlagungen nicht mehr verhehlt werden
konnten. Sein Geist schweift noch heute in dem dortigen Walde umher. Man sieht ihn als einen Mann in einem langen schwarzen Mantel und mit einer
großbeschildeten Kappe auf dem Haupt eilig dahergehen und plötzlich im Eichengebüsch verschwinden.
(Mößinger, Friedrich - Bildstöcke im Odenwald, in: Schriften für Heimatkunde und Heimatpflege im Starkenburger Raum, Heppenheim 1962, S.22-25)
 |